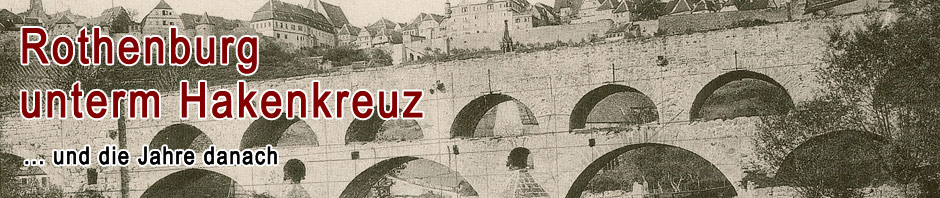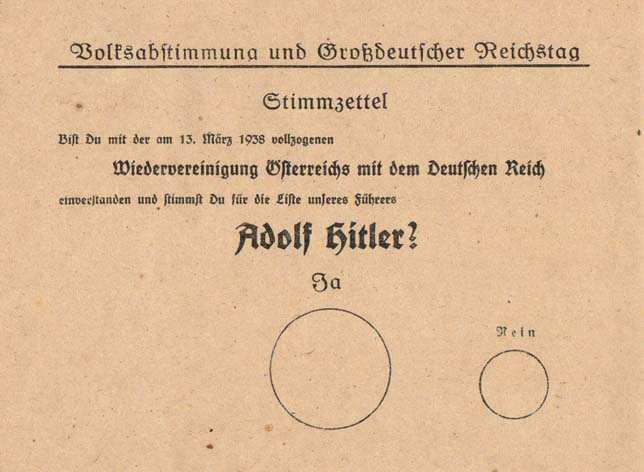Geslau 1936
Von Wolf Stegemann
Einer, der zu den Nationalsozialisten gehörte, der Partei von 1933 bis 1944 und zudem von 1933 bis 1945 der NS-Volkswohlfahrt als Kassenleiter diente, der NS-Kriegsopferversorgung und als Kameradschaftsführer dem NS-Reichskriegerbund sowie Mitglied der Reichsmusikkammer war, zeigte auch offen, dass er mit der Partei und dem Staat nicht immer einverstanden war und Widerstand leistete. Als Kriminalkommissär i. R. blieb dies nicht ohne Folgen, wie es den Entnazifizierungsunterlagen des Georg Beyerlein zu entnehmen ist. Die Spruchkammer Rothenburg unter dem Vorsitzenden Chemnitzer reihte ihn nach mündlicher Verhandlung und Anhörung von Zeugen am 23. Juli 1947 in die Gruppe V der Entlasteten ein (Az. 32/Ges/Bey).
Als Ruheständler zog er 1935 von Nürnberg nach Geslau
Bei seinem Eintritt in die NSDAP im Jahre 1933 war der 1890 in Berolzheim (Altmühltal) geborene Georg Beyerlein Kriminalkommissär in Nürnberg. Auf die Polizeibeamten wurde damals besonderer Druck ausgeübt, der Partei und deren Gliederungen beizutreten. Beyerlein war 1933 Witwer und Vater von vier Kindern. Da er seine Stellung nicht verlieren und in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten wollte, trat er der Partei bei. Zu seinen Gunsten bewertete die Spruchkammer, dass Beyerlein bis 1935 den Kindern der jüdischen Familie Wilmersdörfer in Nürnberg Musikunterricht erteilte. Zudem berücksichtigte die Kammer auch das anhaltende Nervenleiden, das sich Georg Beyerlein bei einer schweren Verschüttung im Ersten Weltkrieg zugezogen hatte. Beyerlein heiratete erneut. 1935 wurde er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt und zog von Nürnberg nach Geslau bei Rothenburg. Hier begann sein Widerstand. Als die Partei dem Geslauer Organisten das Orgelspiel in der Kirche untersagte, übernahm Beyerlein gegen den Willen der örtlichen Partei den Organistendienst, was ihm die Kreisleitung in Rothenburg sowie die Geslauer Nationalsozialisten übel nahmen. Vor den Rothenburger Kreisleiter Karl Steinacker zitiert, sagte Beyerlein, dass er und seine Frau nun befürchten müssten, von den Geslauern „aus dem Dorf hinausgejagt“ zu werden. Den Versuch dazu gab es. Ihm wurde die Wohnung gekündigt. Hauseigentümerin war die Schwiegermutter des Geslauer NSDAP-Ortsgruppenleiters Hans Schwab. Beyerlein fand über Pfarrer Bauer eine neue Bleibe. Wegen kriegbedingter Zerrüttung seiner Nerven kam Beyerlein 1937 vorübergehend in die Heil- und Nervenanstalt Ansbach.
Auseinandersetzung mit dem Geslauer Oberlehrer Völler
Zwischen Georg Beyerlein und dem Geslauer Oberlehrer Karl Völler fand 1939 eine Auseinandersetzung vor dem NSDAP-Kreisgericht in Rothenburg statt (Az. 7/39, 14.4.39). Was war geschehen? Pg. Beyerlein hatte am 23. Dezember 1938 nach Schluss einer Volksweihnachtsfeier den Pg. Völler dadurch beleidigt, dass er ihm dreimal „Herr Lügner“ zurief. Es kann zur Sühneverhandlung in Rothenburg. „Das Parteigericht stellte fest, dass diese Beleidigung unbegründet ist. Pg. Beyerlein nahm seine Beleidigung unter dem Ausdruck des Bedauerns zurück…“ Als Sühne musste Georg Beyerlein innerhalb von acht Tagen 20 Reichsmark an die Kreisamtsleitung der NS-Volkswohlfahrt zahlen. Dem Kreisgericht gehörten an: Oberlehrer Schmidt aus Nordenberg als Vorsitzender, die Pg. Schenk und Philipp als Beisitzer. Am 22. Mai 1939 schrieb das NSDAP-Kreisgericht Georg Beyerlein, dass die Zahlung der 20 Reichsmark noch ausständig sei.
„Sollte sie bis 30. Mai nicht eingegangen sein, müsste das Kreisgericht den Sühnetermin für gescheitert erklären und den Termin zu einer Hauptverhandlung anberaumen. Heil Hitler! Schmidt, Kreisgerichtsvorsitzender Nordenberg.“
Beyerlein wird wohl bezahlt haben. 1939 wurde Georg Beyerlein trotz seiner Kriegsbeschädigung zur Wehrmacht eingezogen, 1940 aber wieder entlassen. 1941 kamen jugoslawische Kriegsgefangene nach Geslau, die dort in der Landwirtschaft arbeiten mussten. Dabei wurden sie von Bewachern immer wieder „äußerst brutal geschlagen“. Georg Beyerlein machte Meldung beim Betreuungsoffizier des zuständigen Gefangenenlagers Stalag C in Hammelburg gegen einen Feldwebel Pirner und einem Obergefreiten Meyerer. Dies missbilligte die NSDAP-Kreisleitung in Rothenburg mit der Folge, dass die Kreisleiter Seitz und Steinacker sowie die gesamte NSDAP-Ortsgruppe Geslau und der Gendarmeriemeister Kopp gegen den widerständigen Pg. Beyerlein agierten.
1943 Ausschluss aus der NSDAP, 1944 vom Parteigericht München bestätigt
Kreisleiter Seitz ließ Georg Beyerlein am 4. Februar 1943 eine Einstweilige Verfügung zustellen. Darin wurde er gem. § 4 Abs. 7 der Parteisatzung mit dem Einverständnis des NSDAP-Kreisgerichts Rothenburg wegen Verstoßes gegen § 4, 2b der Satzung aus der Partei ausgeschlossen. Als Grund wurde angegeben:
„Sie haben als Parteigenosse die Interessen von Kriegsgefangenen wahrgenommen und einen Bericht an die (sic!) Stalag in Hammelburg persönlich überbracht. Kriegsgefangene sind nach wie vor unsere Feinde. Ihre Handlungsweise ist eines Parteigenossen unwürdig. Ihr Verhalten ist gleichzeitig parteischädigend…“
In der Hauptverhandlung am 6. März 1943 wurde die Einstweilige Verfügung des Kreisleiters aufrecht erhalten:
„Der Pg. Beyerlein hat sich für serbische Kriegsgefangene eingesetzt, indem er unter Umgehung der Parteidienststellen eine Anzeige über angebliche Misshandlungen derselben an das M-Stammlager in Hammelburg überbrachte. Er hat dadurch den Bestrebungen der NSDAP zuwidergehandelt, die eine strenge Behandlung der Kriegsgefangenen fordert und es nicht duldet, dass sich Kriegsgefangene in Deutschland ein bequemes Leben machen.“
Unterschrieben von Schmidt, Schenk und Philipp. Der Ausgeschlossene händigte am 5. März 1943 sein Parteibuch Nr. 2.617.872 dem Geslauer Ortsgruppenleiter Hans Schwab aus und legte Einspruch beim NSDAP-Parteigericht München ein. Währenddessen wurde Beyerlein von dem Geslauer Gendarmeriemeister Kopp mit der Drohung, ihn ins KZ überstellen zu lassen, zur Unterschrift gepresst, mit der Beyerlein seine Meldung in Hammelburg über die Misshandlung der Kriegsgefangenen zurücknahm. Gleichzeitig wurde er gezwungen, ab Januar 1944 die Tätigkeit eines Partei-Propagandaleiters zu übernehmen. „Man erklärte mir, dass jeder Beamte oder Pensionist auf Grund eines Reichsgesetzes verpflichtet ist, derartig übertragende Arbeiten zu übernehmen.“ Beyerlein war als Propagandaleiter allerdings nicht aktiv. Die Parteiführer schikanierten ihn nun öffentlich, wo sie nur konnten, ließen ihn Botengänge machen und dergleichen und setzten ihn ihrem Spott aus. Als das Münchner Parteigericht den Ausschluss am 24. August 1944 bestätigte, wurde Georg Beyerlein der Propagandaposten wieder entzogen und die Zahlung seiner Kriegsrente eingestellt. Jetzt wurde er zu Hilfsarbeiten eingeteilt und für vier Monate mit dem Volkssturm „zum Arbeitseinsatz“ nach Oberitalien geschickt.
Seinen Aussagen wurden vom Amtsrichter Rothenburg nicht geglaubt
Im Jahr 1943 gab es noch einen Vorfall in Geslau, der im Zusammenhang mit Kriegsgefangenen stand. Marie Pöhlau aus Pilgramsreuth-Post Rehau machte 1947 vor der Spruchkammer Rothenburg folgende Aussage: Georg Beyerlein habe sich im Jahre 1943 „in einem gegen mich von der NSDAP anhängig gemachten Gerichtsverfahren, „mit seiner ganzen Persönlichkeit eingesetzt und sich daher vollständig gegen die Partei gestellt.“ Dann erklärte sie den Vorfall. Sie war vom August 1941 bis Oktober 1942 mit dem Sohn des damaligen Bürgermeisters von Geslau, Georg Preiss, verlobt. Nach dem zweiten Besuch habe sie die Verlobung gelöst. Während ihrer Besuche bei ihrem Verlobten habe sie auf dem Hof immer mitgearbeitet und kam dabei auch mit dem Kriegsgefangenen Branko Lazarak zusammen, der dort zur Arbeit eingesetzt war. Nach Auflösung ihrer Verlobung mit dem Bürgermeistersohn Georg Preiss wurde gegen sie ein gerichtliches Verfahren wegen „Verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen“ eingeleitet. Das Amtsgericht Rothenburg habe sie am 27. April 1943 zu sechs Wochen Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Georg Beyerlein habe sich damals als Zeuge vor Gericht für die sie eingesetzt. Seinen Aussagen wurde aber kein Glaube geschenkt, da Beyerlein als Gegner der Partei bei Gericht bekannt war.
Jugoslawen bewirkten seine Entlassung aus dem Internierungslager
Nach Einmarsch der Amerikaner wurde Georg Beyerlein am 19. April 1945 von den Amerikanern festgenommen, in das Internierungslager Pöhl-Igelheim gebracht und am 20. Mai in das Camp 71 nach Ludwigsburg überführt. Von dort wurde er am 23. April 1946 aufgrund der Fürsprache der jugoslawischen Kriegsgefangenen, denen er in Geslau beigestanden hatte, entlassen. Als Schlusssatz einer schriftlichen Einlassung für die Rothenburger Spruchkammer schrieb Georg Beyerlein am 18. Januar 1947:
„Mein Los heißt: Vertrauen auf Gott, dann hast du nie auf Sand gebaut und des Weiteren: Treu und Gehorsam der Obrigkeit, die die Macht über mich hat. Dann bitte ich ergebenst Gerechtigkeit walten lassen zu wollen. Ich habe viel gelitten und werde, soweit mir die Möglichkeit dazu gelassen wird, der treue Diener unseres Volkes sein und bleiben, so lange ich lebe. Hochachtungsvoll (Unterschrift) Beyerlein Georg, Krim. Kom. i. R., Wohnung in Geslau 10 bei Rothenburg o/Tauber.“
Von der Spruchkammer Rothenburg als aktiver Widerständler anerkannt
Vor der Spruchkammer Rothenburg bestätigten die Nachkriegsbürgermeister von Geslau, Georg Kammleiter, und von Gunzendorf, Hans Dürolf, die Geschehnisse. Von einem der betroffenen ehemaligen jugoslawische Kriegsgefangenen, Jowonawic Mitorod (so die Schreibweise in den Akten), lag eine schriftliche Bestätigung vor. Die Spruchkammer kam in ihrem Urteil der Entlastung Georg Beyerleins am 23. Juli 1947 zu dem Schluss:
„Durch die Beweisaufnahme im mündlichen Verfahren ist festgestellt worden, dass sich der Betroffene nicht nur passiv verhalten, sondern nach dem Maß seiner Kräfte aktiv Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft geleistet und dadurch Nachteile erlitten hat. Seine Nachteile bestanden nicht nur in dem Entzug seiner Kriegsrente, sondern auch darin, dass sie sich infolge ununterbrochener Verfolgung und Unterdrückung in seelische Zermürbung ausdrückte.“
__________________________________________________________________
Quelle: Staatsarchiv Nürnberg, Bestand Spruchkammer Rothenburg, Nr. 3-62 – 7 T 60