Das Reichsinnenministerium schickte im Juni 1940 über 1.500 Fragebogen an die Neuendettelsauer Pflegeeinrichtung mit der Aufforderung, diese bis zum 1. September ausgefüllt zurückzusenden. Dem kam die Anstaltsleitung nicht nach. Sie schrieb an das Reichsministerium zurück, dass dies aus Personalmangel nicht möglich sei und schlug vor, dies bis zum Kriegsende zurückzustellen.
Daraufhin erschien nach Fristablauf am 2. September 1940 überraschend eine Ärztekommission, bestehend aus 17 Personen. Darunter acht junge Ärzte und Medizinstudenten, ebenso viele Schreibkräfte und ein Kommissionsleiter, der Chefarzt einer staatlichen Heil- und Pflegeanstalt war. Der Historiker Alfred Kugelstein beschreibt diesen Besuch in seinem Buch „Denk- und Merkwürdigkeiten aus Mittelfranken“ so:
„Der Neuendettelsauer Chefarzt Dr. Boeckh, Rektor Hans Lauerer und Pfarrer Ratz waren gerade in Urlaub bzw. hielten sich in Bethel auf, wo es ähnliche Einrichtungen gab. Die damalige Oberin, Selma Haffner, fragte dort an, wie sie sich verhalten sollte. Man gab ihr zu verstehen, dass es nicht möglich sei, sich der staatlichen Anordnung zu widersetzen. Es blieb ihr nicht anderes übrig, als die Patientenakten herauszugeben.
Als Pfarrer Ratz und Dr. Boeckh aus Bethel zurückgekommen waren, protestierten sie gegen die Maßnahme mit dem Hinweis, dass die Meldebögen nur im Benehmen mit dem zuständigen Arzt ausgefüllt werden dürften.
Inzwischen hatte man bereits einige hundert dieser Bögen nach Berlin geschickt. Die Kommission reagierte auf die Proteste nicht und schloss ihre Arbeit am 3. September, einen Tag nach ihrer Ankunft bereits ab. Weitere Beschwerden in Berlin und München führten lediglich zu Zusagen, die Meldebögen zu überprüfen und gegebenenfalls nach Neuendettelsau zurückzusenden. Dr. Boeckh untersuchte daraufhin alle mit den Bögen erfassten Patienten noch einmal und erstellte eine Liste mit den schwersten Fällen, um ,zu retten, was zu retten war’.“
1978/79 Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum Mord
Weil er diese Liste der schwersten Fälle anfertigt hatte, wurde gegen ihn 1978/79 ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen „versuchter Beihilfe zum Mord“ eingeleitet, das jedoch eingestellt wurde. Zurück zum Jahr 1940:
„Weitere Versuche des Landesbischofs Meiser und Hilferufe an den Regierungspräsidenten und den Nürnberger Oberbürgermeister konnten nicht verhindern, dass die geplante Aktion anlief. Der Leiter der Bruckberger Heime (Filiale von Neuendettelsau), Pfarrer Harleß, rief im Herbst 1940 das Pflegepersonal zusammen und berichtete „mit bewegter Stimme“, dass Kranke in einer nach Baden verlegten Anstalt „in einer nahegelegenen Vernichtungsanlage umgebracht worden seien“. Das überlieferte eine Bruckberger Diakonisse und fuhr fort: „Erstaunt, stumm, ja fast ungläubig hörten wir den Bericht!“
Gestapo ermittelte gegen die Anstaltsleitung
Busse der „Gemeinnützigen Transport GmbH“ holten die Patienten in Neuendettelsau und den Filialen Bruckberg und Polsingen mit dem Versprechen ab, einen „schönen Ausflug“ zu unternehmen. Dieser Ausflug ging nach einem kurzen Aufenthalt in Günzburg in eine Todesanstalt, wo die Patienten umgebracht wurden.
„In Neuendettelsau trafen Todesnachrichten ein, in denen von Lungenentzündung und Blinddarmdurchbruch die Rede war, auch bei Patienten, die schon lange ohne Blinddarm gelebt hatten.“
Am 12. Februar 1941 sprachen der Neuendettelsauer Rektor Lauerer sowie die Pfarrer Ratz und Burkert bei der Bezirksregierung Ansbach vor und äußerten die Befürchtung, dass die Abtransporte aus Neuendettelsau mit der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ zu tun haben könnten. Diese Befürchtung wurde von der Bezirksregierung als verleumderisch zurückgewiesen und ihnen ein Verfahren vor dem Sondergericht Nürnberg angedroht. Schon am nächsten Tag erschien in Neuendettelsau die Gestapo und nahm Ermittlungen auf. Die Anstaltsleitung ließ sich nicht einschüchtern, sondern versuchte ihre Patienten durch Verlegung in Altenheime oder Wirtschaftbetriebe zu verlegen, um sie vor dem Zugriff der staatlichen T4-Mord-Aktion zu retten. In ein eigens neu gegründetes Heilerziehungsheim wurden 160 Kinder verlegt. Die Todesmaschinerie lief weiter. Noch im Februar wurden Patienten aus den Heimen Neuendettelsau, Bruckberg, Polsingen und Engelthal abgeholt. Dazu Alfred Kugelstein:
„Ein Kranker verabschiedet sich mit den Worten: ,Wir sehen uns beim Herrn Jesus wieder, Brauchst net greina, ich grein auch net!’ Ein anderer: ,Ich nehme nichts mit. Alles können sie mir nehmen, nur nicht meinen Heiland!’ Diese Äußerungen lassen erkennen, dass zumindest ein Teil der Pfleglinge das Ziel ihrer ,Reise’ kannte. Manche wurden von Unruhe und Angst geplagt. Eine Frau klammerte sich flehend an die Hausmutter: ,Ich will noch nicht sterben, rette mich doch!’“
Tötungen offiziell beendet – Vernichtung der Menschen ging dennoch weiter
Leerstehende Häuser in Neuendettelsau und den Filialen wurden beschlagnahmt und für die Kinderlandverschickung genutzt. Auch wurden dort umgesiedelte Volksdeutsche und gebrechliche Südtiroler untergebracht. Von den 1.700 Patienten der Anstalt Neuendettelsau und ihren Filialen überlebten 500 Patienten. 1.200 fielen der Todesmaschinerie des Staates zum Opfer. Wenn auch am 24. August 1941 die T4-Todesaktion auf Grund der großen Unruhe in der Bevölkerung offiziell beendet wurde, so liefen die Tötungen behinderter Menschen bis 1945 weiter.
Siehe die Artikel: Euthanasie I
Euthanasie II
Euthanasie IV
_______________________________________________________________
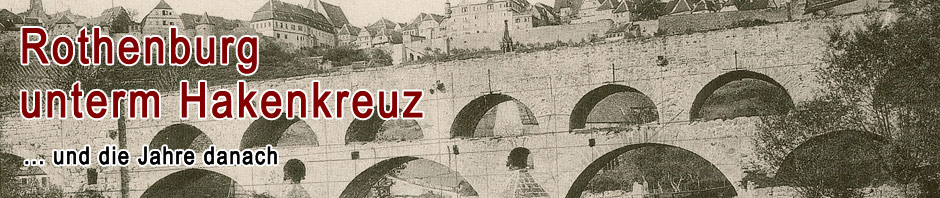



3 Responses to Euthanasie III: Neuendettelsauer Pflegeeinrichtung im Griff der gnadenlosen T4-Aktion „Vernichtung lebensunwertes Lebens“ – rund 1.200 Patienten wurden getötet